Die kleinen Seelen der Ägäis
Atherinas sind kaum größer als ein kleiner Finger. Sie leben in großen Schwärmen und ihre Bestände gelten, im Vergleich zu manchen Artgenossen, als stabil. Kleine Fischereien in Griechenland werfen ihre Netze nach ihnen aus und sind damit ökologisches Vorbild für eine ganze Industrie.

Acht ägyptische Fischer, die ihr Handwerk beherrschen. Ein griechischer Kapitän, der seit 35 Jahren zur See fährt und die Ägäis praktisch im Blut hat. Ein alter Kutter, der genauso heißt wie das Dorf, in dem sein Hafen liegt: Agios Georgios. Eine Nacht außerhalb der Komfortzone und mit erstaunlichen Erkenntnissen. Über Europa, die Fischerei und über das Fischen am unteren Ende der Nahrungskette.
Am frühen Abend, kurz vor Sonnenuntergang, kehrt Ruhe ein, am Steg von Agios Georgios. Die Ausflugsboote der TouristInnen sind längst im Hafen, die TouristInnen, viele sind es hier ohnehin nicht, verteilen sich auf die Handvoll Tavernen im Dorf. Am Steg sitzen ein paar Männer und flicken Netze. Sie warten auf ihren Kapitän. Auf »Käpt’n Lambros« und auf die Nacht. Und sie hoffen auf guten Fang. Etwa zwölf Stunden werden sie im Meer zwischen der Insel Evia und dem griechischen Festland kreuzen und ihre Netze einholen. Die Art, wie sie fischen, ist jahrhundertealtes Handwerk. Was sie fangen, ist nicht mehr das Gleiche wie noch vor zehn Jahren. Die Menge der gefangenen Fische wird ebenso kleiner wie die Fische selbst. Kleine Ährenfische und Bastardmakrelen. Der Großteil des Fangs wird aus diesen beiden Fischarten bestehen. Was sonst noch im Netz landet, wird man sehen.

Außerhalb Griechenlands (und Teilen der Türkei) haben es kleine Fische wie die Atherinas, die Kleinen Ährenfische, nicht einfach. Der Markt will große, feste und vor allem grätenfreie Filets. »Nose to tail« beim Fisch ist im Mainstream noch nicht angekommen. Dabei wäre es ökologisch viel sinnvoller, vermehrt kleine Fische auf die Speisekarte zu setzen. Einfach weil sie kürzere Reproduktionszyklen haben und sich daher schneller erholen als Kabeljau, Thun oder Seeteufel. Von der geschmacklichen Horizonterweiterung dieser im Ganzen frittierten Winzlinge ganz zu schweigen.
Exkurs: Am Grund der Bürokratie
Lambros Paugeros‘ Fischgründe liegen in der Ägäis. Genauer gesagt im nördlichen Golf von Evia. In der Sprache der Bürokraten und Diplomaten gehört das zum FAO-Fanggebiet 37. Untergebiet 3 (Östliches Mittelmeer), Bereich 37.3.1 (Ägäis). In diesem Bereich gelten die beiden Fischarten, die Lambros‘ Fang noch vor einem Jahrzehnt dominiert haben, als überfischt und gefährdet: Sardellen und Sardinen. Der Fischer spürt den Rückgang deutlich. Die FAO spricht von massiven Bestandsreduktionen (teilweise um mehr als 50 %). Vor allem durch pelagische Schleppnetze, die es durch ihre Größe und Struktur auf Schwarmfische abgesehen haben. Sowohl für Sardinen als auch für Sardellen gibt es daher Fangquoten, um sicherzustellen, dass sich die Bestände erholen können. Mit durchwachsenem Erfolg. 2017 hat die EU eine von der Kommission in Auftrag gegebene Studie präsentiert, der zufolge 93 % der mediterranen Bestände als überfischt gelten. Lambros kennt diese Studie nicht. Er sieht nur, dass ihm keine Sardellen und Sardinen mehr ins Netz gehen.
Um etwa acht Uhr werden die Taue gelöst. Die Netze sind am Boot verstaut, die Akkus der Signalbojen aufgeladen, die Beiboote festgezurrt. Alles ist an seinem Platz. Lambros Paugeros, der Käpt’n, beobachtet das Treiben an Bord und schenkt sich die dritte Tasse Kaffee aus seiner Thermoskanne ein. Plötzlich wird es hektisch. In der Mitte des Bootes wird Platz gemacht. Ein paar Kisten werden zusammengestellt, eine Holzplatte daraufgelegt. Weitere Kisten als Sitzgelegenheiten rund um den provisorischen Tisch gestellt, dann kommt die Pfanne. Frisch gegrillter Fisch. Kleine Makrelen, ein paar Sardellen, ein paar, von denen keiner wusste, wie sie heißen. Eine Schüssel Couscous und Tomaten. Für den Couscous gibt es einen Löffel, die Fische werden mit der Hand gegessen.

Dann beginnt die Arbeit der Fischer. An bestimmten Koordinaten werden Netze ausgelegt und mit Signalbojen markiert. Früher wurde dafür eine gasbetriebene Flamme verwendet. Heute leuchten hundert kleine LEDs mit einer Strahlkraft, dass man die Bojen auch vom Festland aus sehen könnte. Lambros braucht das nicht. Er findet seine Bojen. Auch ohne dass sie leuchten wie ein Weihnachtsbaum. Kurz vor Mitternacht werden die ersten Stellnetze vom Vortag eingeholt. Der Fang. Ein Beiboot holt dabei die Netz-Enden von der Boje ins Boot, dann übernehmen die schnellen Seilwinden. Erst ganz zum Schluss stellen sich die Fischer in einer Reihe an der Bordwand auf und ziehen den Rest des Fangs an Bord. Davor zieht ein kleiner Lastenkran das gefüllte Netz über die Reling und entleert das Netz über einem Auffangbehälter. Es ist ein bizarrer, lebendiger Anblick, wenn Tausende von Kleinen Ährenfischen, keiner größer als ein kleiner Finger, über das Deck gehievt werden. Ein silbern glänzender Klumpen mit klitzekleinen zappelnden Fischen. Das Wasser im Auffangtank brodelt, und der Schiffsboden ist übersät mit Quallen und kleinen Fischen. Nach einer knappen halben Stunde ist alles vorbei. Die Netze sind leer, das Wasser in den Tanks wird abgelassen, die Fische werden sortiert, verpackt und auf Eis gelegt. Im Laufe der nächsten Stunden wird sich das noch ein oder zwei Mal wiederholen. Dann, um etwa drei Uhr morgens, kehrt auch an Bord der Agios Georgios etwas Ruhe ein. Die Seemänner ruhen sich in der Kajüte aus, einer sitzt am Bug und schaut in den Himmel, andere versuchen, auf den klammfeuchten Netzen am Heck ein wenig Schlaf zu finden. Um halb vier liegt ganz zart süßlicher Marihuana-Duft in der Luft.

Gegen sieben Uhr läuft die Agios Georgios im gleichnamigen Hafen ein. Der Kutter wird vertäut, die Ladung gelöscht. Lambros schnappt sich einen Sack mit etwas größeren Fischen und schlendert nach Hause. Das Team aus Ägypten macht das Boot klar.
Käpt’n Lambros hat genug
Ein paar Tage später treffe ich Lambros noch einmal. In einem kαφενείο, einem Kaffeehaus, in dem sich die älteren Herren des Dorfes auf einen eleniko, einen griechischen Mokka, treffen und Τάβλι, also Backgammon spielen. Wir sprechen über den Fang in dieser Nacht (wirklich zufrieden ist Lambros damit nicht), über die Fangmethoden (die sich – zumindest seit er selbst hinausfährt – nicht geändert haben), über die Fischbestände (er meint, dass seit 2008 alles weniger und die Fische kleiner werden) und über seine Crew. Es sind Ägypter, sagt er. Sie haben das Meer und das Fischen im Blut. Sie sind gut in ihrem Job. Womit eigentlich alles gesagt ist. Wer arbeitet nicht gerne mit Profis.
Die Fische aus Lambros‘ Fang werden auf den Märkten auf Evia und in die ansässigen Tavernen verkauft. Der Gewinn reicht, um der Crew einen fairen Lohn zu zahlen, die Familie zu versorgen (Lambros ist verheiratet und hat zwei Töchter) und um das Boot in Schuss zu halten. Mehr will er auch nicht. Lambros wirkt tiefenentspannt und grundzufrieden mit sich und seinem Leben. Die industriellen Fangschiffe mit ihren Schürfnetzen, die Treibnetze im Pazifik oder die Grundschleppnetze, die sich durch den Atlantikboden pflügen und dort keinen Stein auf dem anderen lassen, gehören nicht zu seiner Welt.
Die Kleinen Ährenfische, die zum großen Teil in seinen Netzen landen, gehören in Griechenland zu den Klassikern der hellenischen Küche. Die Zubereitung ist einfach. Sie werden einfach im Ganzen frittiert und in einer Schüssel mit einer halben Zitrone serviert. Außerordentlich einfach, und trotzdem gibt es kaum ein Gericht, das stärker mit dem Meer verbunden wäre als ein Teller Atherinas.

Atherina boyeri, so der wissenschaftliche Name der Kleinen Ährenfische, werden in Griechenland entweder über beach seines, das sind Wadennetze, die vom Land aus eingeholt werden, gefangen oder mit Stellnetzen, wie Lambros und seine Crew sie verwenden. Der Beifang hängt dabei stark vom restlichen Fischbestand des Gebiets ab. Im Fall unserer gemeinsamen Nacht auf See war er praktisch null. Die Fischereiprofis vom WWF sehen das ähnlich und stellen dem kleinen Schwarmfisch ein – ökologisches – Unbedenklichkeitszeugnis aus: »Die Art ist kurzlebig und widerstandsfähig gegenüber Fischerei, da sie sich schnell reproduziert und daher schnell wieder erholen kann. Es werden wie gesagt oft Stellnetze (Kiemennetze) eingesetzt, die moderate Beifänge und Rückwürfe aufweisen und keine gefährdeten Arten betreffen (also zum Beispiel Robben, Schildkröten, Haie oder Ähnliches). Ebenso werden langfristige Auswirkungen auf das Ökosystem sowie Lebensraumeffekte als unwahrscheinlich angesehen«, meint Axel Hein, der Fischexperte des WWF Österreich.

Kurz zusammengefasst: Was Lambros und seine maghrebinischen Matrosen aus dem Meer holen, ist nachhaltig. Auch wenn die Männer das Wort so nie verwenden würden. Es ist auch essenzieller Teil europäischer, mediterraner Kultur. Allein die Art, wie die Fischer ihre Netze flicken, ist ein Handwerk, das weit in die Geschichte des Mittelmeers und seiner Menschen zurückreicht.
Fangquoten und andere Regulative sind wichtig, keine Frage. »Das Meer braucht eine Pause« lautet der Untertitel einer österreichischen TV-Serie über die Vorzüge regionalen Fischkonsums. Damit trifft sie den Nagel auf den Kopf. Die Fischbestände müssen die Chance haben, sich zu erholen. Aber würden mehr Fischer so handeln wie Lambros Paugeros aus Agios Georgios, müssten die Pausen nicht so lange sein.
BIORAMA #60



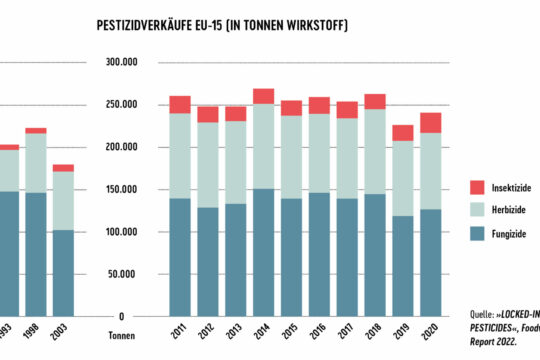




 Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.
Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.