Mund auf, Augen zu
Manche Tiere streicheln wir, die anderen schmecken uns. Der junge Forschungszweig der Anthrozoologie untersucht die widersprüchliche Beziehung des Menschen zum Tier und gerät dabei vor einer moralischen Zwickmühle in die nächste.
Wer hübsch ist, wird nicht gefressen. Wenn es um unser Essen geht, machen wir Menschen es uns gerne einfach. Den Tieren machen wir es dafür umso schwerer. Besonders, wenn sie nicht unseren ästhetischen Anforderungen entsprechen. Ob wir sie in Massentierhaltungen etwa verunstaltet haben, um aus ihnen funktionierende Fleischspender zu machen, spielt in dieser Entscheidung kaum keine Rolle. Tiere mit dem falschen Äußeren oder unsympathischen Angewohnheiten wie Blut zu saugen oder Kot zu fressen können bei der menschlichen Gesellschaft so oder so wenig punkten. Denn der moralische Status wird ihnen ihrem Ansehen nach zugebilligt, meint der US-Psychologe Hal Herzog. Diese und andere Missverhältnisse verdeutlicht er in seinem Buch »Wir streicheln und wir essen sie«. So kommt es, dass wir uns lieber für Tiere einsetzen, die schön anzuschauen sind – Tiger, Elefanten oder Delfine zum Beispiel. Andere hingegen, die vielleicht ebenso einzigartig und schützenswert sind, verabscheuen wir, weil sie hässlich sind. Der chinesische Riesensalamander ist beispielsweise das größte Amphibium der Welt (und der größte lebende Vertreter der Schwanzlurche). Seine Gattung ist vom Aussterben bedroht. Doch sein knapp zwei Meter großer und 60 Kilogramm schwerer sackartiger Körper sieht nicht gerade fesch aus. Deshalb ist er den meisten Menschen auch egal, argumentiert Herzog. Seine Ausrottung ist also lediglich eine Frage der Zeit – oder nicht?
Den Widersprüchen auf der Spur
Die Menschen sehen sich als rational denkende Wesen am oberen Ende der Nahrungskette. Die Widersprüche und Ungereimtheiten in unseren Beziehungen zu anderen Erdbewohnern sind jedoch unübersehbar. Abgesehen davon ist der menschliche Alltag natürlich voller moralischer Widersprüche. Nur werden diese, so Herzog, in unserem Verhältnis zu Tieren insbesondere sichtbar. Menschen reagieren oberflächlich auf Tiere, erklärt uns sein Buch. Den chinesischen Riesensalamander und dessen Imageproblem führt er als ein Beispiel dafür an, wie widersprüchlich das Verhältnis zwischen Menschen und Tieren ist. Die Gründe dafür seien vielfältig: »Instinkte verführen uns dazu, uns in großäugige Wesen mit weichen Gesichtszügen zu verlieben. Genetik und Erfahrung bewirken, dass wir vor manchen Tieren Angst haben und vor anderen nicht. Unsere Kultur bestimmt, welche Gattungen wir lieben, hassen oder essen sollen«. Erschwerend würde hinzukommen, dass wir oft im Konflikt zwischen Vernunft und Gefühl stünden. Außerdem würden wir leider dazu neigen, unsere eigenen Vorstellungen auf andere zu projizieren, resümiert der US-Wissenschaftler. Auf 315 Seiten findet er reichlich erschreckende wie unterhaltsame Exempel und Anekdoten, um diverse Paradoxien zu veranschaulichen. Er schreibt von Vegetariern, die verlegen zugeben, Fleisch zu essen; Kampfhahnzüchtern, die ihre Tiere lieben und sie wie Athleten trainieren; von Hundefreunden, deren Wunsch, eine Rasse zu verbessern, Generationen von genetischen Defekten geschaffen hat oder von Menschen, die Tiere unter üblen Bedingungen horten aber behaupten, sie vor der schlechten Außenwelt zu retten.
Es wenigstens versuchen
Hal Herzog gehört zu den Vorreitern der Human-Animal Studies, der sogenannten Anthrozoologie. Die relativ junge interdisziplinäre Wissenschaft untersucht genau diese Gegensätzlichkeiten im Umgang der Menschen mit anderen Lebewesen. Die zentrale existenzielle Frage ist, was eigentlich darüber bestimmt, ob ein Tier schützenswert ist? Laut Herzog ist unsere Moral diesbezüglich viel weniger von Logik abhängig als wir glauben. In der Auseinandersetzung mit Tieren seien für den Menschen Intuitionen und Gefühle viel entscheidender. Den eigenen Sinn für Nachhaltigkeit einmal aktiviert, drängen sich für Konsumenten fast täglich grundsätzliche Fragen zum Umgang mit Tieren auf. Sie werden liebkost und geschlachtet, geschützt und gequält. Letzteres ist häufig auch ein in der Forschung geübtes Mittel zum Zweck wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns. Wenn der Autor dabei von seinen inneren moralischen Konflikten im eigenen Forschungslabor berichtet (z.B. beim Kochen von lebenden Nagetieren im Sinne der Wissenschaft), ist sein Dilemma ein altbekanntes und erfreut sich als Fragestellung in der Öffentlichkeit gerade wieder großer Beliebtheit: Dürfen wir töten, um besser zu leben?
Herzog beobachtet jedenfalls, dass wir in öffentlichen Debatten vermehrt über Tierrechte reden. Zur gleichen Zeit würden viele Arten mit zunehmender Geschwindigkeit ausgerottet werden. Noch nie zuvor hätten sich so viele Menschen für den Tierschutz engagiert oder zumindest Interesse dafür gezeigt. Zeitgleich verschlechtere sich aber auf globaler Ebene die Situation für Tiere massiv. Was »Wir streicheln und wir essen sie« als Antwort liefert, ist keine befriedigende Handlungsanweisung, aber zumindest ein Anfang. Im persönlichen Umgang mit den eigenen moralischen und ethischen Widersprüchen zu Tieren könne man weder dem Herz noch dem Kopf vertrauen, lautet hier das Fazit. Widersprüche sind nicht anormal, sondern unvermeidlich. Ein moralisch unbeflecktes Verhältnis zu Tieren sei eben schwer möglich – aber zumindest erstrebenswert. Hal Herzog schlägt vor, sich an Menschen zu orientieren, die wenigstens versuchen, mit diesen Widersprüchen reflektiert umzugehen. Die Anthrozoologie könne dabei helfen, sich diesen Dilemmas des Alltags anzunähern. Um sie wenigstens besser verstehen zu können, die Tiere und die Menschen.
Das Buch »Wir streicheln und wir essen sie. Unser paradoxes Verhältnis zu Tieren« von Hal Herzog ist im Hanser Verlag erschienen.
- #anforderung
- #ansehen
- #Anthrozoologie
- #arten
- #ästhetisch
- #athleten
- #auseinandersetzung
- #ausrottung
- #außenwelt
- #bedingung
- #beziehung
- #blut
- #buch
- #debatte
- #denken
- #dilemma
- #erdbewohner
- #Essen
- #Fleischspender
- #forschung
- #forschungslabor
- #gefressen
- #gefühl
- #gegensätze
- #generation
- #genetik
- #Hal Herzog
- #human-animal studies
- #hundefreund
- #intuition
- #Kampfhahnzüchter
- #konflikt
- #körper
- #massentierhaltung
- #mensch
- #moralisch
- #Nachhaltigkeit
- #nahrungskette
- #paradox
- #rasse
- #rational
- #riesensalamander
- #schmecken
- #streicheln
- #Tier
- #tierrechte
- #Tierschutz
- #ungereimtheit
- #veernunft
- #Vegetarier
- #verhältnis
- #wesen
- #widerspruch
- #Wir streicheln und wir essen sie



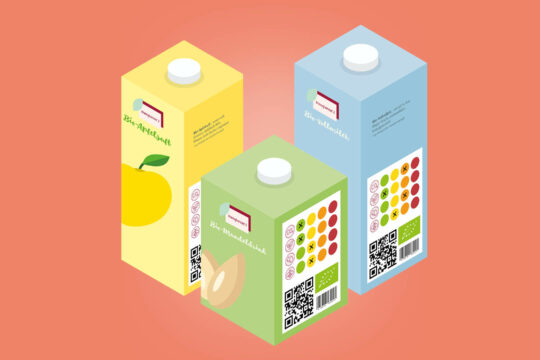






 Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.
Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.