Auch bei Frost im Freien
Im Stall oder auf der Weide? So verbringen Biotiere die kalte Jahreszeit.

Saftige Almen und sonnenüberflutete Wiesen, auf denen Kühe friedlich grasen. Fröhlich über Kräuter und Wildblumen springende Ziegen. So sieht das typische landwirtschaftliche Tier in Produktmarketing und Tourismuswerbung aus. Viele Nutztiere würden ihrer Biologie entsprechend auch die Zeit zwischen November und März im Freien verbringen – manche dauernd, andere zeitweise. Der Aufenthalt im Freien entspricht den natürlichen Bedürfnissen vieler Tiere. Niedrige Temperaturen und weniger vorhandene Nahrung auf den Weiden stellen Herausforderungen für die Organisation der Nutztierhaltung dar – aber grundsätzlich nicht mehr, als im Sommer Auslauf und Schutz vor Wetter und Witterung zu bieten. In der industriellen, konventionellen Stallhaltung gibt es für die meisten Nutztiere kaum Jahreszeiten. Auch in der Biohaltung ist die ganzjährige Möglichkeit für die Tiere zum Aufenthalt im Freien noch eher die Ausnahme – was natürlichem, artgerechtem Verhalten am nächsten kommt, ist von Art zu Art unterschiedlich.
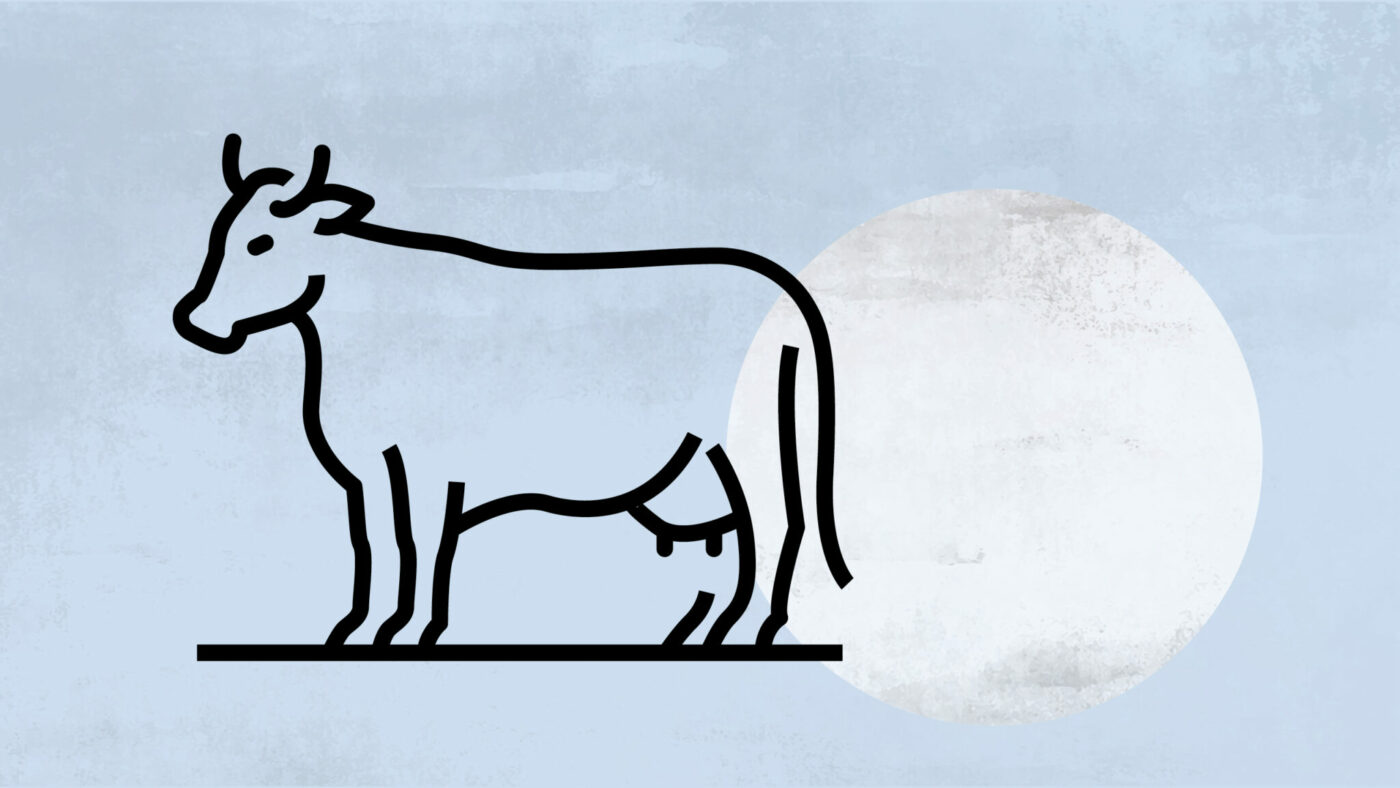
Rinder
Brauchen Kühe im Winter einen Stall? Nicht unbedingt. Prinzipiell können alle Rinderrassen ganzjährig draußen sein – vorausgesetzt, dass die Tiere früh genug an niedrigere Temperaturen gewöhnt werden und Zeit haben, eine Fettschicht und Winterfell zu entwickeln. Außerdem müssen die Tiere genügend zu fressen haben. Reichen die auf den winterlichen Weiden für die Tiere auffindbaren Gräser nicht aus, dann muss zugefüttert werden. Solange aber ausreichend Futter zur Verfügung steht, fühlen sich Rinder bei trockener Kälte wohl – jedenfalls ist diese für die Tiere verträglicher als extreme Hitze im Sommer. Lediglich nasskaltes Wetter macht ihnen zu schaffen. Zum Schutz gegen dieses brauchen sie trockene, witterungsgeschützte Liegemöglichkeiten auch im Freien.
Wie viel Zeit Kühe im Freien verbringen, hängt von der Art der Haltung ab. Ganzjährig angebundene Haltung ist aber auch in der konventionellen Haltung europaweit rückläufig und in manchen Staaten verboten. So inzwischen auch in Österreich – allerdings läuft noch eine Übergangsfrist für Ausnahmefälle, die etwa auch in »baulichen Gegebenheiten am Betrieb« begründet sein können. Ab 2030 allerdings müssen sich alle Rinder – unabhängig vom Tierhaltungsstandard – an mindestens 90 Tagen im Jahr frei bewegen können. Auch in Schweden oder der Schweiz ist die durchgehende Anbindehaltung verboten. In Deutschland ist diese Form der Rinderhaltung noch erlaubt, wird aber seltener. Zwischen 2010 und 2020 sank die Zahl der Rinder in Anbindeställen von drei Millionen auf etwas mehr als eine Million – was etwa zehn Prozent des gesamten Rinderbestandes entsprach. Ein Gesetzesentwurf der mittlerweile aufgelösten »Ampelkoalition« sah ein Verbot der ganzjährigen Anbindehaltung noch in diesem Jahr vor. In Frankreich, dem Land mit dem größten Rinderbestand innerhalb der EU, ist immer noch etwa ein Drittel der Tiere permanent angebunden. In Italien ist die Situation ähnlich.
Schottisches Hochlandrind
Alle europäischen Rinderrassen kommen gut mit niedrigen Temperaturen zurecht. Die in dieser Hinsicht robusteste Rasse ist das Schottische Hochlandrind. Für dieses sind auch mehr als minus 20 Grad kein Problem. Das dichte Fell dieser Tiere führt allerdings dazu, dass sie sich bei hohen Temperaturen nicht wohlfühlen.
Für die Biohaltung gelten EU-weit verbindliche Vorschriften: Von April bis einschließlich Oktober müssen die Tiere Zugang zu einer Weide haben. Davon können nur dann Ausnahmen gemacht werden, wenn die Witterungsbedingungen, der Zustand des Bodens oder etwa eine Erkrankung eines Tieres eine Weidehaltung unmöglich macht. Aber auch für die Zeit von November bis März gibt es klare Regelungen für unterschiedliche Haltungsarten. Eine durchgehende Haltung im Laufstall in den kalten Monaten ist nur dann zulässig, wenn im Gegenzug zwischen April und Oktober das sogenannte »Maximum an Weide« garantiert ist. Das heißt, dass von Frühling bis Herbst nicht nur ausreichend Bewegung, sondern auch genügend Futter auf der Weide zur Verfügung stehen muss und die Tiere also die gesamte warme Jahreszeit draußen verbringen können. Die optimale Variante ist die »ganzjährige Weidehaltung«. Diese ist dann gegeben, wenn die Tiere das ganze Jahr hindurch im Freien gehalten werden. Für die Wintermonate muss aber auch bei dieser Haltung ein trockener und windgeschützter Witterungsschutz vorhanden sein.
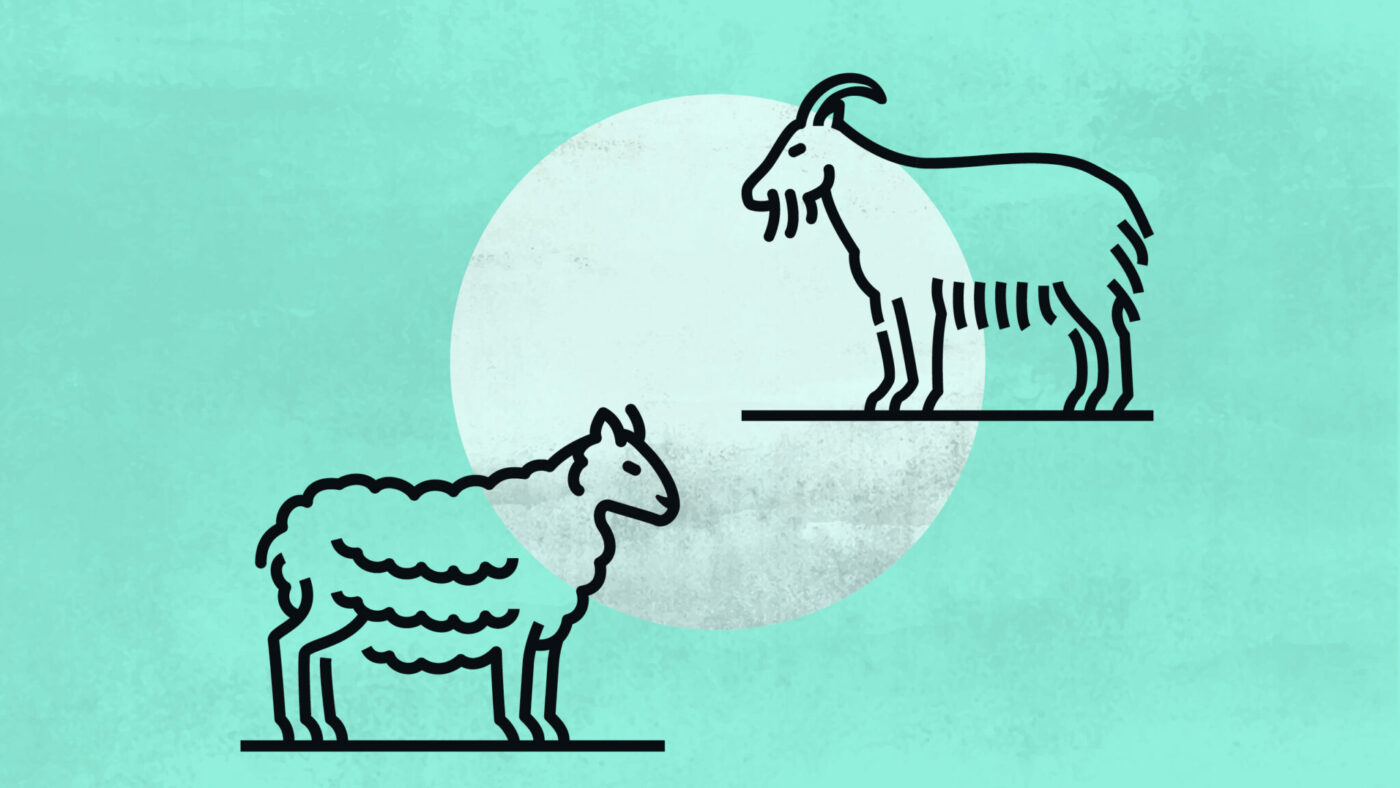
Schafe
Die Regelungen für die Freilandhaltung von Schafen sind jenen für Rinder sehr ähnlich. Die Anbindehaltung bei Kleinwiederkäuern, also bei Schafen und Ziegen, ist in Deutschland und Österreich unabhängig von der Art der Haltung verboten. Ausnahmen sind nur für Einzeltiere zeitlich begrenzt möglich, etwa wenn ein Tier krank ist. In der Biohaltung gilt auch bei Schafen, dass die Tiere in der warmen Jahreszeit von April bis Oktober Zugang zu Weideflächen haben müssen. Aber auch danach sind Schafe gerne im Freien. Jene mit wolligem Fell sind für tiefe Temperaturen besonders gut ausgestattet. Hängt Schnee im Fell von Schafen, dann ist dies kein Alarmzeichen, sondern sichtbarer Beweis für eine funktionierende Wärmeregulierung: Fettschicht, Blutgefäße und Fell ergeben zusammen einen so guten Schutz, dass kaum Körperwärme der Tiere nach außen dringt und den auf dem Fell haftenden Schnee zum Schmelzen bringen könnte. Für Schafe gilt dasselbe, was für viele Tiere gilt: Draußen zu sein entspricht zu jeder Jahreszeit ihren natürlichen Bedürfnissen.
(K)ein Winterkleid
Wollschafe entstanden erst durch Domestizierung. Der vom Menschen seit Jahrtausenden weiterverarbeitete Rohstoff Wolle ist ein Produkt gezielter Züchtung.
Die Schur von Wollschafen ist unbedingt notwendig – für ungeschorene Schafe sind hohe Temperaturen und das zunehmende Gewicht des Fells unerträglich.
Ziegen
Das gilt auch für Ziegen. Auch diese Tiere halten sich das ganze Jahr über am liebsten außerhalb des Stalls auf. Eine simple Weide ist für Ziegen allerdings nur die Minimalausstattung. Für diese Tiere sollten Auslaufmöglichkeiten außerdem auch attraktiv gestaltet werden und etwa Möglichkeiten zum Klettern bieten – auf Steinen, Felsen und Hängen fühlen sich die Tiere erst richtig wohl. Und wie bei allen Tieren gilt, dass auch für Ziegen Schutzmöglichkeiten für regnerisches und windiges, aber auch für heißes Wetter vorhanden sein sollten. Vor allem Nässe vertragen Ziegen nicht besonders gut, und auch gegenüber Kälte sind sie empfindlicher als Schafe. Ein trockener Unterstand ist für diese Tiere in der kalten Jahreszeit also besonders wichtig.
Ziegen sind übrigens jene vierbeinigen Nutztiere, die in Österreich und Deutschland am häufigsten nach Bio-Kriterien gehalten werden. Mehr als 50 Prozent sind es in Österreich, in Deutschland liegt der Anteil bei knapp über 30 Prozent. Am anderen Ende dieser Skala rangieren die Schweine, bei denen der Anteil der biozertifizierten Tiere in beiden Ländern immer noch einstellig ist.
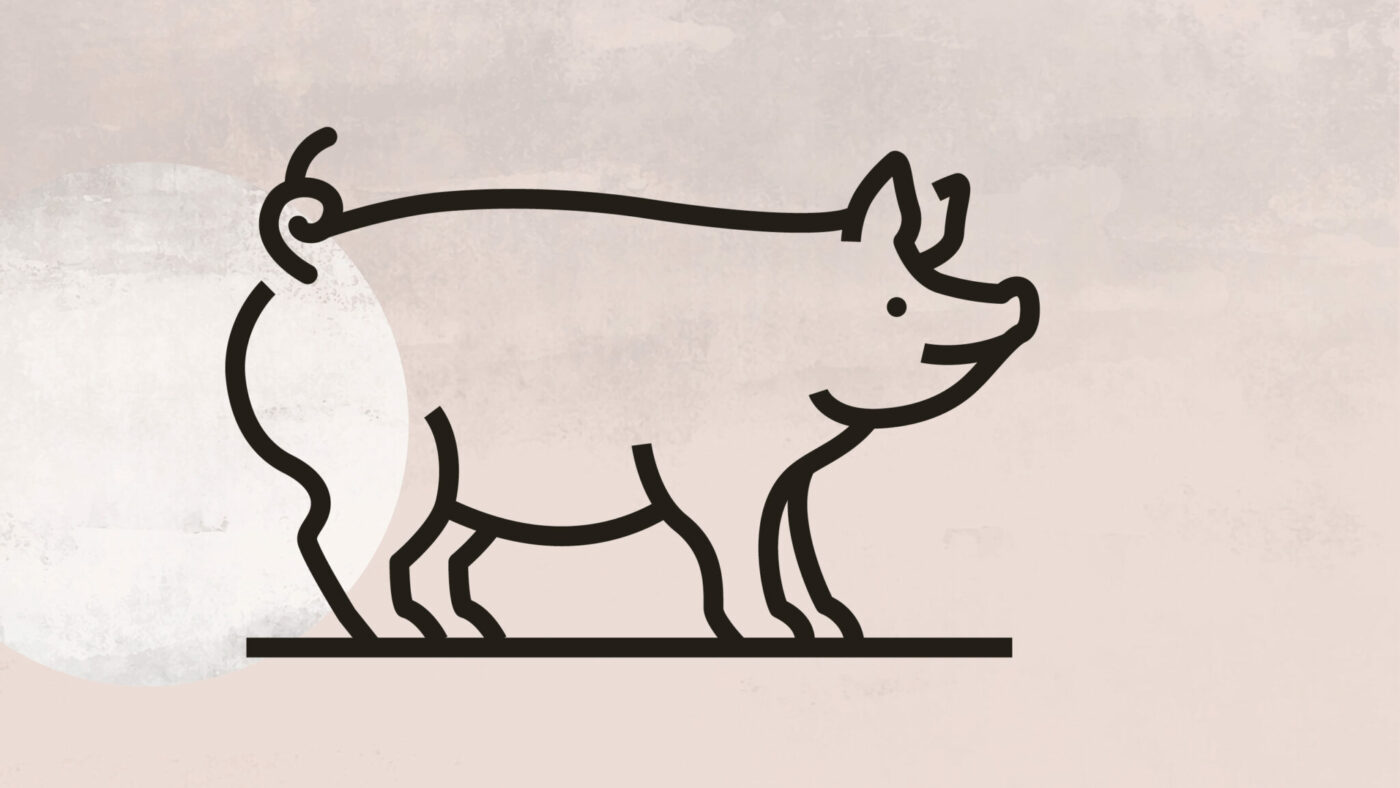
Schweine
Schweine sind keine Weidetiere im klassischen Sinn. Die Freilandhaltung von Schweinen ist in Österreich und Deutschland zudem immer noch wenig verbreitet – die ganzjährige Freilandhaltung dementsprechend noch seltener. Dabei würden sich auch Schweine zu allen Jahreszeiten draußen am wohlsten fühlen, solange sie einen Unterstand mit Stroh haben, in dem sich die Tiere aneinandergekauert teilweise eingraben können. Alle in Mitteleuropa gängigen Schweinerassen – und nicht etwa nur die felligen Wollschweine – halten Minusgrade gut aus. Die wilden Vorfahren des Hausschweins, die Wildschweine, bekommen durch die milder werdenden Winter mittlerweile sogar ganzjährig Nachwuchs – ein Indiz dafür, dass mitteleuropäische Kälte kaum ein Thema für Schweine ist.
Für Biobetriebe ist ein Auslauf verpflichtend, der ständig begehbar ist. Allerdings muss der Auslauf nicht zwingend auf einer Weide erfolgen. Hinzu kommt, dass bei einer Weidehaltung zwei Flächen vorhanden sein müssen. Eine Übernutzung von Weiden durch Schweine kann dazu führen, dass sich Keime und Parasiten ausbreiten. Eine ausreichend große Fläche – bzw. zwei Flächen – ist also unabdingbar, damit sich der Boden erholen kann. Schweine brauchen außerdem Suhlstellen, um sich im Freien wohlzufühlen. Eine spezielle Schwierigkeit bei der Freilandhaltung von Schweinen ist die Gefahr einer Übertragung von Schweinepest oder Maul- und Klauenseuche durch Wildschweine. Doppelte Zäune mit Untergrabungsschutz helfen dabei, dies zu verhindern, sind aber in der Errichtung teuer. Freilandhaltung von Schweinen ist in Österreich und Deutschland wenig verbreitet, dabei sind die Tiere gut dafür geeignet. Für unbehaarte Hausschweine ist allerdings die Sonne ein Problem im Sommer, sie kriegen schnell Sonnenbrand, wenn sie keinen Schatten haben.
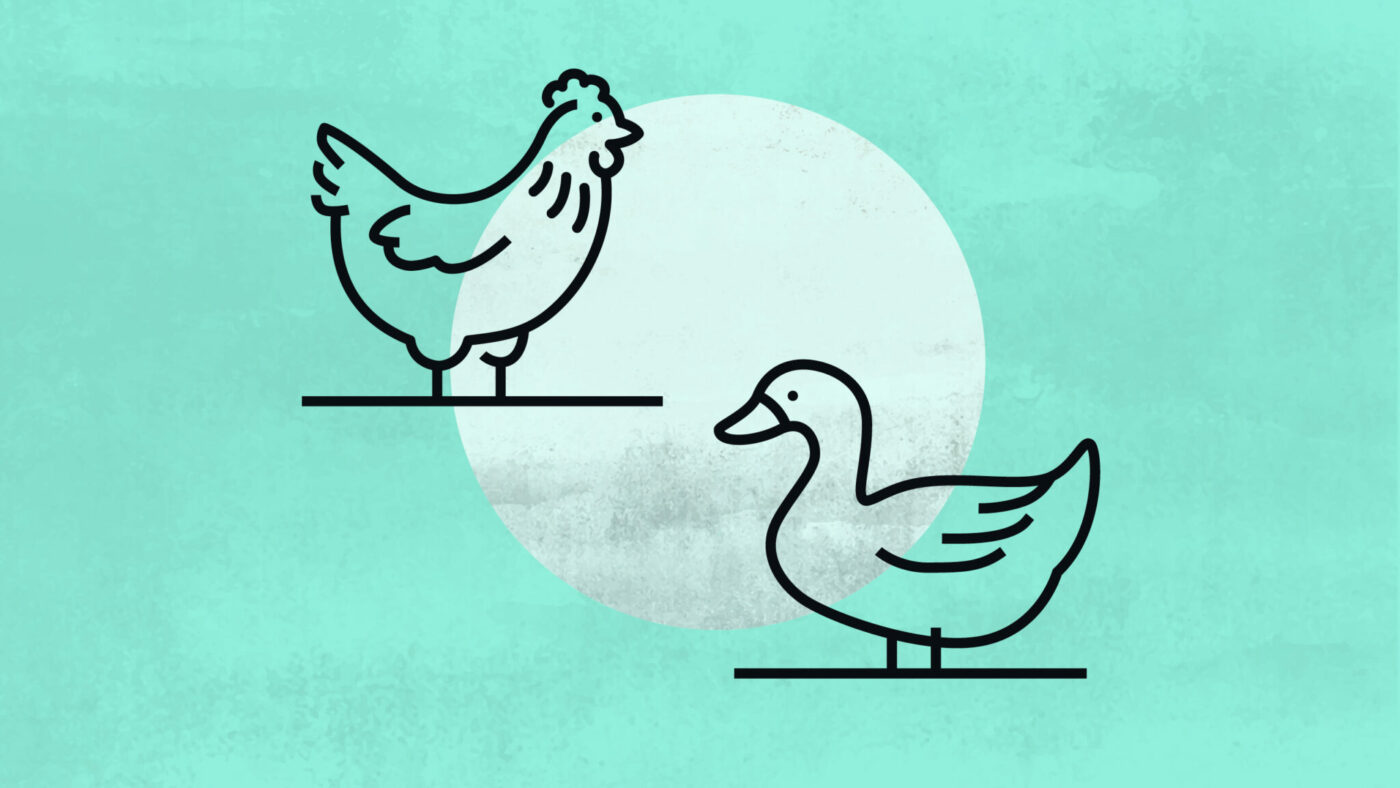
Hühner & Enten
Auch Geflügel kann ganzjährig im Freien gehalten werden. Für Enten ist der Winter ohnehin kaum ein Problem. Die meisten Rassen sind für niedrige Temperaturen mit Fett und Federn ausgestattet. Manche Entenarten verweigern zudem selbst bei Schnee und Minusgraden den Stall und übernachten das ganze Jahr über im Freien. Bei Hühnern ist die Lage etwas komplizierter. Zwar können auch diese prinzipiell gut mit niedrigen Temperaturen umgehen, doch benötigen sie weit mehr Komfort als Enten. Ein gut ausgestatteter und ausreichend großer Stall mit Sitzstangen ist aber ohnehin eine der Voraussetzungen für die artgerechte Haltung von Hühnern. Die Richtlinien für Biohaltung sind bei Hühnern etwas weniger komplex als bei anderen Tieren. Die grundlegenden Parameter sind aber auch bei diesen Tieren die Größe der Flächen von Stall und Auslauf sowie der ausschließliche Einsatz von Biofutter und ein sehr eingeschränkter Einsatz von Medikamenten. Während in der konventionellen Boden- bzw. Freilandhaltung neun Tiere pro Quadratmeter Stall erlaubt sind, dürfen es in der Biohaltung maximal sechs beziehungsweise bei vorhandenem Außenscharr-Raum sieben Tiere sein. Der vorbeugende Einsatz von Medikamenten ist mit einer Biozertifizierung nicht vereinbar. Auslaufmöglichkeiten sind natürlich ebenfalls verpflichtend – mindestens zehn Quadratmeter pro Henne müssen es sein.

Honigbienen
Im Sommer ist die Honigbiene überall anzutreffen – auf Weiden, Blühstreifen und im Gastgarten –, aber was macht das staatenbildende Insekt im Winter? Bereits bei Temperaturen unter zwölf Grad Celsius ist die Flugfähigkeit von Bienen stark eingeschränkt, ab acht Grad können sie sich kaum mehr bewegen. Doch die Tiere haben eine komplexe Überwinterungsstrategie entwickelt. Es gibt Sommer- und Winterbienen. Während die im Frühjahr schlüpfenden Sommerbienen vorwiegend für die Honigproduktion zuständig sind, ist es Aufgabe der im Herbst schlüpfenden Winterbienen, das Volk über die kalte Jahreszeit zu bringen. Die Bienen bilden bei niedrigen Temperaturen in ihrem Stock eine Traube. In deren Mitte sitzt – gut geschützt vor der Kälte – die Königin. Die Bienen sind ständig in Bewegung und erzeugen durch Muskelkontraktion Wärme. Die außen in der Bienentraube hängenden Tiere werden immer wieder von weiter innen sitzenden Bienen abgelöst. Ins Freie fliegen die Tiere nur bei höheren Temperaturen zum Entleeren der Kotblase. Die unterstützende Aufgabe des Imkers ist es, dafür zu sorgen, dass nach der Honigernte genug Nahrung vorhanden ist, mit der die Bienen gut über den Winter kommen.
Stirbt der Winter aus?
Die globale Klimaerwärmung macht sich nicht nur durch Hitzesommer bemerkbar. In den letzten 35 Jahren stieg die im Winter gemessene Durchschnittstemperatur in Deutschland deutlich an.
Zwölf der 13 Winter mit den höchsten Mitteltemperaturen seit 1761 fielen in diesen Zeitraum. Die wärmsten Winter wurden 2006/07 und 2019/20 registriert.
Dabei ist das Bienenvolk im Winter sehr klein, die Königin beginnt aber teilweise bereits ab Januar/Februar wieder Eier zu legen: anfangs wenige, damit, wenn plötzlich alles blüht (Weiden, Obstbäume etc.), genügend Bienen da sind, die sammeln können. Das Prinzip dahinter lautet: Viele Bienen sammeln in der Vegetations- und Blühzeit Nektar, Pollen, Honig, mit dem dann wenige Bienen über einen harten Winter kommen können. Es ist von Natur aus normal, dass jeden Winter bis zur Hälfte bis zur Hälfte eines jeden Bienenvolkes stirbt. Ein gesundes Bienenvolk teilt sich dann zwischen April und Juni (»Schwärmen«), und dann sind wieder doppelt so viele Völker vorhanden.
Keine Sorge!
Immer wieder sind SpaziergängerInnen alarmiert, wenn sie bei eisigen Temperaturen Tiere auf Weiden oder Wiesen beobachten. Doch es gibt keinen Grund zur Sorge. Denn immerhin ist das Freie der natürliche Lebensraum für Tiere – auch wenn diese als Nutztiere eng an den Menschen gebunden sind. Ein dichteresFell, Winterpelz oder eine Fettschicht schützen Rinder, Schafe und Ziegen vor Kälte und Nässe. Auch Bewegung regt den Kreislauf der Weidetiere an und sorgt für zusätzliche Wärme. Wenn sie rechtzeitig an den Temperaturrückgang gewöhnt werden, Zugang zu ausreichend Futter sowie zum Schutz vor starkem Wind oder Regen ein trockenes Plätzchen aufsuchen können, können sie weite Teile des Winters ohne Probleme im Freien verbringen – dort, wo die meisten Tiere sich am liebsten aufhalten.
Mehr zum Thema artgerechte Haltung und Tierwohlstandards gibt es hier.

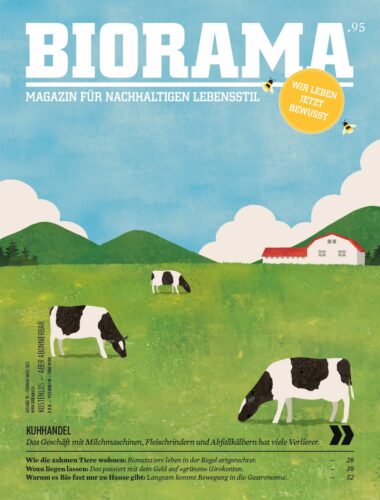






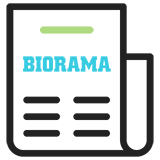
 Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.
Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.