Trinkend die Welt verändern – Jakob Berndt im Interview
Vor fünf Jahren haben Jakob Berndt, Paul Behtke und Felix Langguth den Entschluss getroffen, sich aktiv am gesellschaftlichen Wandel zu beteiligen. Wir haben den Geburtstag als Anlass genommen, um mit Jakob über sein Social Business, Fairtrade und gesellschaftlichen Wandel zu sprechen.
Vor fünf Jahren haben die drei Lemonaid-Gründer bereits erkannt, dass soziale und Umweltprobleme auch immer mit unserem Konsumverhalten zusammenhängen. An dem Punkt wollten sie ansetzen. Seitdem verkaufen sie sehr erfolgreich ihre Bio- und Fairtrade-Limos und -Eistees, Lemonaid & Chari Tea. Zusätzlich zu den fairen Preisen, die sie für ihre Rohstoffe bezahlen, fließen fünf Cent pro verkaufter Flasche in Entwicklungsprojekte in den Anbauregionen. Im letzten Jahr sind dabei 175.000 Euro in den Lemonaid & Chari Tea e.V. geflossen. Um zu sehen, wo und wie das Geld den Menschen vor Ort hilft, besuchen Mitarbeiter regelmäßig die Kleinbauernkooperativen und die geförderten Projekte. Bei der letzten Projektreise ist dabei ein kleiner Film entstanden, der den Limo- und Teetrinkenden Menschen in Deutschland und Österreich einen Einblick in das Leben in Sri Lanka geben soll.
BIORAMA: Seit mittlerweile fünf Jahren verkauft ihr eure Bio- und Fairtrade-Getränke in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gab es bei euch ein Schlüsselereignis, dass euch dazu gebracht hat, mit einer Limo die Welt verbessern zu wollen?
Jakob Berndt: Für Paul waren das sicherlich die Erlebnisse und Eindrücke während seiner Arbeit für die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Sri Lanka. Dort ist der Wunsch verstärkt worden, sich entwicklungspolitisch zu engagieren – aber dieses Engagement unternehmerisch zu gestalten. Sprich: das Geld selbst zu verdienen, mit einem guten und fairen Produkt und effektiven und professionellen Methoden. Und die Profite dann eben dorthin zurückfließen zu lassen, wo entwicklungspolitscher Bedarf ist, in unserem Fall: in die Anbauregionen unserer Zutaten.
Gab es in den letzten fünf Jahren einen Moment, an dem ihr alles hinschmeißen wolltet?
Es gab, vor allem in der Gründungsphase einige Situationen, wo man für einen Moment nicht weiter wusste, kein Land mehr sah, nicht wusste: Wie lösen wir das jetzt? Aber hinschmeißen? Nein, nie! Auch wenn das pathetisch klingen mag: Dafür waren der Spaß und die Überzeugung immer zu groß und auch das Feedback rundherum einfach positiv.
Die verschiedenen Fairtrade-Siegel sind immer wieder der Kritik ausgesetzt, die Kriterien seien zu vage und der tatsächliche Nutzen für die Fairtrade-Bauern zu gering. Alles Quatsch oder besteht bei den Siegeln und Standards Verbesserungsbedarf? Wenn ja, wo kann man als Konsument ansetzten?
Wir bemühen uns ganz bewusst, uns nicht allein auf die bestehenden Siegel zu verlassen. Wir bereisen regelmäßig die Anbauregionen, haben fast alle unsere Bauern und deren Arbeits- und Lebensgewohnheiten selbst kennengelernt. Dabei gab es durchaus Situationen, wo wir gesagt haben: Das geht besser, das ist uns noch nicht fair genug. In der Konsequenz sind wir zu anderen Kooperativen gewechselt, wo aus unserer Sicht bessere Bedingungen herrschen, also z.B. demokratische Strukturen, keine Abhängigkeitsverhältnisse, klarer Fokus auf kommunale Entwicklung etc. Das heißt dann natürlich oft auch: Man muss noch mehr für die Rohwaren bezahlen. Aber das tun wir, alles andere würde unserem Grundsatz zuwider laufen, die Akteure am Anfang der Wertschöpfungskette wirklich zu respektieren und zu stärken.
Wir verfolgen die Debatten über die Qualität von Fairtrade-Siegeln sehr genau – und an einigen Kritikpunkten ist sicher etwas dran. Gerade der Einstieg der ganz großen Player droht die Grundidee des fairen Handels zu gefährden, also z.B. die Förderung kleinbäuerlicher Strukturen. Aber man muss sich hier vor pauschalen Urteilen hüten, das Thema ist sehr komplex. Wir können in unserem Fall sagen (und das können sicher die wenigsten): Wir waren selbst dort und haben uns ein Bild gemacht. Zudem gilt bei uns ja die „mehr als fair“-Devise: Wir finanzieren, weit über den „klassischen“ fairen Handel hinaus, mit jeder verkauften Flasche bei und mit unsern Bauern entwicklungspolitische Projekte. Darauf sollten sicher auch die Verbraucher künftig noch mehr achten: Wie glaubhaft vertritt ein Unternehmen die proklamierten Werte? Was hat es mit all den bunten Logos wirklich auf sich? Was steckt an Substanz dahinter? Das ist aufwendig, ja. Aber letztlich auch die Verantwortung jedes Einzelnen – zumal viele der Informationen heute verfügbar sind.
Oft wird Herstellern von Produkten, die einen sozialen Zweck versprechen, nachgesagt, dass der soziale Aspekt nur Marketing sei. Was konkret mit dem Geld, das durch Produktverkauf generiert wird, umgesetzt wird, steht auch bei euch in der Kommunikation nicht im Vordergrund. Warum redet ihr so wenig darüber?
Tun wir das? Ja, vielleicht habt Ihr Recht – wir sind da bisher nicht so offensiv mit umgegangen. Zum einen natürlich, weil wir glauben, dass wir zunächst einmal unsere Arbeit gut machen und wirklich Ergebnisse schaffen müssen (in Sachen Projektarbeit), bevor wir groß ins Horn blasen. Zum anderen ist unsere Geschichte ja auch etwas komplexer und anspruchsvoller als bei jemandem, der nur sagt „Wir sind die Saubersten“ oder „Wir haben am meisten Koffein“. Aber nun, wo wir seit fünf Jahren dabei sind, alle Regionen bereist haben und mittlerweile wirklich sehenswerte Unterstützung leisten können, sprechen wir auch mehr darüber. Weil wir wirklich etwas zu sagen haben.
Ihr unterstützt mit eurem Verein Kleinbauernkooperativen und gemeinnützige Projekte in den Anbauregionen eurer Produkte. Was zieht ihr für eine Bilanz – seht ihr, dass sich etwas verändert?
Für eine detaillierte Bilanz fehlt hier sicher der Raum. Aber wir können, bei all unseren Projekten, auf eine positive Entwicklung blicken. Wir haben nachhaltige Strukturen geschaffen (z.B. durch die Finanzierung mehrerer Grundschulen in Paraguay), wir befähigen unsere Partner dauerhaft (z.B. durch Solaranlagen und Trainings für unsere Rooibos-Bauern) und haben wahnsinnig wichtige Projekte wieder zum Leben erweckt (z.B. das DTI in Sri Lanka) – wo wir auf jeder Projektreise spüren, dass dort wichtige Impulse gegeben werden.
Alle eure Mitarbeiter besuchen regelmäßig die unterstützten Projekte. Wie wird eure Arbeit von den Menschen vor Ort wahrgenommen? Stoßt ihr auch auf Kritik?
Bisher nicht, ehrlich gesagt. Das Feedback ist durchweg positiv. Wir sind natürlich nicht davor gefeit, künftig auch mal Fehler zu machen. Dennoch: Wir entwickeln die Projekte ja zusammen mit den lokalen Partnern, mit Kooperativen oder kleinen NGOs – und beziehen dadurch die Interessen der Menschen vor Ort ganz direkt mit ein. Wir wollen keinen Neo-Kolonialismus, sondern echte Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Faitrade-Produkte sind im Vergleich relativ teuer. Was glaubt ihr muss sich hier ändern, damit sozial- und umweltverträgliche Produkte keine „Luxus-Artikel“ mehr sind. Ist ganzheitlich nachhaltiger Konsum eine Utopie in weiter Ferne?
Wir sind da ja auf einem guten Weg, wenn auch noch recht weit am Anfang. Noch sind wir nicht am Ziel, aber perspektivisch wäre es toll, wenn Bio- oder Fairtrade-Produktion keine Alleinstellungsmerkmale mehr sind, sondern Hygiene-Faktoren. So wie man heute in Deutschland prinzipiell davon ausgehen kann, dass Produkte sicher sind – was in anderen Teilen der Welt keine Selbstverständlichkeit ist.
Damit das Realität wird, kommen sicher einige Faktoren zusammen: Die Politik muss klare Rahmenbedingungen schaffen wollen, die Transparenz für Hersteller zur Pflicht machen. Verschleierung und Etikettenschwindel gehören verboten. Die Verbraucher müssen sich ihrer Verantwortung und Macht bewusst werden – denn jeder Kaufakt ist auch eine politische Handlung. Die fairen und sauberen Hersteller dürfen nicht müde werden, ihrer Haltung treu zu bleiben – und dennoch ein attraktives Paket zu schnüren, denn allein aus moralischen Gründen werden die wenigsten Produkte gekauft. Eine Limo muss schmecken, ein T-Shirt sitzen, usw. – und faire Produkte müssen das umso mehr, wenn sie ihren Mehrpreis, der übrigens so hoch meist gar nicht ist, rechtfertigen wollen.
Die „Guten“ müssen eben auch in den „konventionellen“ Kategorien der jeweiligen Branche, also Geschmack, Design, etc., die Besten sein. Dann haben die Bösen langfristig keine Chance.
Weitere Infos:
lemon-aid.de
www.lemonaid-charitea-ev.org




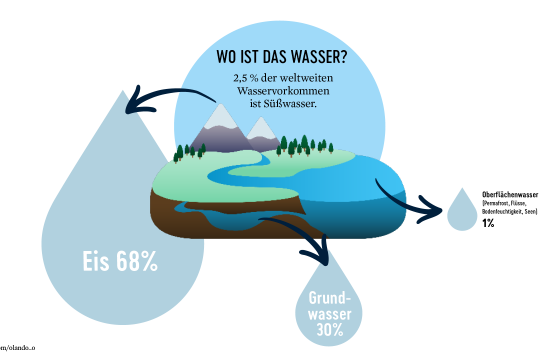




 Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.
Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.