Das Treibhaus und sein Effekt
In europäischen Glashäusern werden inzwischen immer häufiger exotische Früchte und Gemüse gezogen. Rechnet sich das?

Kleintettau ist nur der Anfang. Zumindest, wenn es nach dem wissenschaftlichen Leiter des Projekts »Klein-Eden«, Ralf Schmitt, geht: Auf 3500 Quadratmetern wachsen hier in Bayern Kakaofrucht, Maracuja, Mango, Papaya, Guave, Sternfrucht und sogar Jackfruit im Glashaus – gefördert vom Staat Bayern und der Europäischen Union und inzwischen auch begleitet von einiger medialer Aufmerksamkeit. 2013 wurde begonnen, mit knapp 200 tropischen Früchten und Gemüse zu experimentieren. Seither hat Gärtnermeister Schmitt in Kooperationen mit Forschungseinrichtungen Kulturen und Anbauweisen adaptiert, das meiste verworfen und weitergetüftelt. Manch exotische Fantasie muss also gleich vorweg enttäuscht werden: »Mango, Banane und Co. brauchen spezielle Standorte oder werden Riesenbäume. Wir verfolgen nur mehr Sachen, bei denen wir einen hohen Ertrag auf kleiner Fläche erzielen.«
Dieser Kalkulation ist inzwischen auch einer der Tausendsassa unter den regionalen Exoten in spe zum Opfer gefallen: Der beliebte Fleischersatz Jackfruit braucht zu viel Platz, Pflege und Zeit, um in Klein-Eden irgendwann absehbar gewinnbringend kultiviert zu werden: »Wir haben Jackfruit schon auch noch stehen – geschmacklich funktioniert ihr Anbau optimal. Aber den Aufwand zahlt uns keineR.« Generell hätten sich verholzende Kulturen aus den genannten Gründen als schwierig herausgestellt, man konzentriert sich derzeit auf Papaya, Sternfrucht und Guave.

Biotopfpapaya nach Protokoll
Seit 2017 sind allerdings die Früchte aus dem Tropenhaus biozertifiziert und werden unverarbeitet und auch zu Fruchtmus verarbeitet – dann aber ohne Biozertifikat – gehandelt. »Die Spritzmittel, die für solche Kulturen weltweit eingesetzt werden, sind in Deutschland gar nicht zugelassen. Für uns war daher klar, dass wir von Anfang an biologisch wirtschaften wollen, statt erst nach ein paar Jahren auf Bio umzustellen. Der Prozess war unkompliziert, weil wir die Kriterien wunderbar einhalten können«, verneint Schmitt die Frage, ob der Preis des Experimentierens aufwendige Zertifizierungsprozesse bedeutet. Immerhin wird hier abseits der für Deutschland und Europa gängigen Standardprozedere kultiviert und gedüngt und nicht nur im beheizten Glashaus, sondern auch in einem Mix aus Erdkultur und Topfkultur produziert. »Für die Biozertifizierung bei den Topfkulturen gibt’s die Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen, ähnlich wie bei Heidelbeeren«, erklärt Schmitt.
Um den Klimafußabdruck eines Lebensmittels zu berechnen, werden alle Emissionen – etwa Lachgas, Methan und CO2 – entlang des Wegs eines Produktes zu CO2-Äquivalenten zusammengerechnet.
Biozertifiziert, aber freilich beheizt – spätestens da wird das nachhaltigkeitssensibilisierte Ohr hellhörig. Allerdings mit der Abwärme einer 500 Meter entfernten Glashütte. Die zuvor ungenützte Abwärme wird einfach durch eine Leitung ins Gewächshaus geblasen. Schmitt rechnet vor: »Würden wir mit Öl heizen, hätten wir einen Verbrauch von 120.000–140.000 Litern. Wir heizen klimaneutral.« Strom wird noch zugekauft, insgesamt schätzt Klein-Eden seine Klimabilanz aber auf null, denn der Glashausdschungel bindet ja auch CO2.
Den Begriff »klimaneutral« hört wiederum Guido Reinhardt grundsätzlich gar nicht gern. Der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Energie- und Umweltforschung (IFEU) in Heidelberg setzt sich seit Jahren mit dem ökologischen Fußabdruck von Lebensmitteln und dessen Berechnungsmöglichkeiten auseinander. Er ist deutlich: »Klimaneutralität ist Augenauswischerei. Denn Anbau, Dünger, Traktortreibstoffe und Kühlungsenergie vom Landwirtschaftsbetrieb bis zum Handel können nicht kein CO2 emittieren. Das ist in den meisten Fällen völliger Unfug.« Vor allem aufgrund der enormen Lachgasmengen, die beim konventionellen wie auch beim biologischen Anbau von Landwirtschaftsprodukten freigesetzt werden.
»Mit Klimaneutralität und ›CO2-frei‹ meint man CO2-Äquivalent-frei und das ist technisch bei Lebensmitteln nicht möglich«
Guido Reinhardt
Wenn bei Lebensmitteln Klimaneutralität als Werbeslogan eingesetzt wird, ist das also Anlass zur Skepsis. Bei Landwirtschaftsprodukten ist dem Naturwissenschafter zufolge das Ziel, möglichst wenig CO2 zu produzieren. »Mit Klimaneutralität und ›CO2-frei‹ meint man CO2-Äquivalent-frei und das ist technisch nicht möglich.« Wo von Klimaneutralität die Rede ist, wird sie durch Kompensationshandlungen und -käufe erreicht. Ob CO2-Handel der richtige Weg ist, will Reinhardt nicht eindeutig beantworten.

Guido Reinhardt
Der Naturwissenschafter ist wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Energie- und Umweltforschung Heidelberg und forscht zu den Schwerpunkten Biomasse und Ernährung.
Bild: IFEU.
One World
Es sei eine nachvollziehbare Perspektive von ProduzentInnen, »über ein Projekt eine Glocke zu legen«, doch für eine sinnvolle Beurteilung müsse man eine ganze Region oder im Idealfall die ganze Welt unter dieser einen Glocke betrachten. Denn die vorhandenen Produktionsmittel würden eben so und nicht anders genützt. »Ökobilanzierer sagen auch bei Düngemitteln: Wenn jemand sie einsetzt, kann jemand anderer sie nicht einsetzen. Ihr Verbrauch verursacht also an anderer Stelle CO2-Emissionen. Fast alles, was ich verbrauche, könnte ich immer auch woanders einsetzen.«
»Die KonsumentInnen müssen damit klarkommen, dass sie dann plötzlich wissen, wo Lebensmittel herkommen und wie es den Leuten geht, die in der Ernte beschäftigt waren.«
Ralf Schmitt
In Klein-Eden tüftelt man allerdings umfassend daran, den Ressourcenverbrauch gering zu halten, zum Beispiel, indem der Fokus auf kompakte Pflanzen in Topfkultur gelegt wird, die mit Regenwasser versorgt werden. Gleichzeitig versucht man gezielt solche Ressourcen einzusetzen, die anders kaum genützt werden können. Düngung durch Aquaponik, bei der die Barsche mit Pflanzenresten gefüttert und an die regionale Gastronomie verkauft werden. Und die Abwärme, könnte man die denn nicht auch anders nützen?
»Nein«, sagt Schmitt, »weil wir haben keine Vorlauftemperaturen von über 50 Grad. Damit fällt die Idee einer Beheizung von Wohnungen flach.« Dazu müssten außerdem mehr Leute im Industriegebiet wohnen, über Distanzen Wohnhäuser zu versorgen sei in diesem Niedertemperaturbereich nicht sinnvoll möglich. Dieser spezielle Umstand macht die Sache auch für Guido Reinhardt vertretbar. »In Westeuropa gibt es Bereiche, in denen die Abwärme nicht richtig genutzt werden kann. Projekte zu deren Nutzung sind sinnvoll.« Klein-Eden mitgemeint – Reinhardt kennt das Projekt selbstredend, bremst allerdings die Hoffnungen, dass die Abwärme-Glashäuser im ganz großen Stil Schule machen werden. »Hier wird man keine Blaupause für Tausende von Fällen finden, aber Insellösungen, die nachhaltig und sinnvoll sind, gibt es immer wieder. Wenn sich das dann wirtschaftlich trägt, ist es okay.«
Ja, wenn. Ein Großteil jener Unternehmen, die – übrigens meist in Südeuropa – durch Beheizung Tropenfrüchte und Co. produzieren, pfeift allerdings auf die Ökobilanz, nicht auf die (Betriebs-)Wirtschaftlichkeit. Am anderen Ende des Spektrums, in Klein-Eden, braucht es öffentliche Zuschüsse und versteht man sich einerseits zum Teil auch als Forschungsprojekt, das die Möglichkeiten auslotet, ökologisch verantwortungsvolle Produktion mit Wirtschaftlichkeit zu verbinden: In den Forschungskooperationen wurde zuerst mit der Universität Bayreuth und derzeit wird mit der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf kooperiert. Die größeren Projekte sind immer mit Doktorarbeiten verbunden und diese gefördert. »Das wissenschaftliche Personal ist bei solchen Projekten der größte Punkt, dann folgen die Laborkosten für unsere Analysen. Letztere liegen bei 35.000 Euro für die Laufzeit des derzeitigen Versuchs von 2021–2024.«
Andererseits ist man von Rentabilität nicht mehr ganz so weit weg, weil man diversifizierte Vermarktungsideen und einen Markt gefunden hat. Und gerade mit dieser Erfahrung betont Schmitt: »Ein reiner Produktionsbetrieb wird sich mit diesen exotischen Früchten aus dem Glashaus über den Lebensmitteleinzelhandel nicht rechnen.«
Für all jene aber, die kaum anders nützbare Abwärme haben und noch nicht so recht wissen, was sie damit anfangen sollen, will Klein-Eden Beratungsleistungen anbieten. Im Moment passiert das nur vereinzelt, auf Anfrage. »Aus Österreich und der Schweiz melden sich mitunter Betriebe, aber bisher nur einer aus Deutschland. Wir sind zwar mit EU-Mitteln entstanden, aber es gab bisher kein darüber hinausgehendes Interesse der EU-Institutionen.« Das geringe Interesse erklärt sich Schmitt mit dem hohen Koordinationsaufwand und der absehbar aufwändigen Vermarktung: »Es ist schwierig. Du musst Industrie und Landwirtschaft zusammenbekommen. Die Industrie will sich eigentlich nicht mit Landwirtschaft beschäftigen und die Landwirtschaft hat Angst vor der Industrie. Und die KonsumentInnen müssen sich dran gewöhnen, ein bissl mehr für ein Produkt zu zahlen. Und damit klarkommen, dass sie dann plötzlich wissen, wo Lebensmittel herkommen und wie es den Leuten geht, die in der Ernte beschäftigt waren.«
Vor allem den geschützten Anbau auf Dachflächen, in Städten wie auch in der Peripherie, stellt sich Schmitt hier konkret vor: »Wir haben Schwerindustrieregionen, mit Abwärme und Brachfläche.« Hier, so lautet die Vision, könnte insgesamt ressourcenschonender Anbau stattfinden – der nicht zuletzt auch weniger abhängig von Importen mache: »Corona hat ja gezeigt, sobald die Kühlcontainer knapp waren, gab’s kaum mehr Exoten in Europa. Wie in Deutschland gegen die LandwirtInnen gewettert wird im Namen des Klimawandels, wird in erster Linie bedeuten, dass wir zukaufen.«

Ralf Schmitt
Der Gärtnermeister ist wissenschaftlicher Leiter und Geschäftsführer des Landwirtschafts- und Forschungsbetriebs Tropenhaus Klein-Eden.
Bild: Klein-Eden.
CO2 ist nicht alles
Ob und warum er Lebensmittelimporten grundsätzlich skeptisch gegenübersteht, beantwortet Schmitt mit einem Fokus auf einen der größten Exporteure von Obst und Gemüse in die Europäische Union: »Ich möchte kein Lebensmittel aus China kaufen, ich vertraue europäischen Kontrollorganen mehr, vor allem den Verbandszertifikaten, mehr als Importen.« Auch Reinhardt sieht Vorteile einer Produktion in Westeuropa aufgrund damit verbundener Standards – Umwelt- wie Arbeitsstandards. Zieht daraus allerdings andere Schlüsse: Er möchte deswegen den Import biofairer Produkte empfehlen, »damit wir Menschen in den produzierenden Ländern nicht in dem Maß ausbeuten, in dem wir das jetzt tun«. Und er ist kategorischer Befürworter von Importen all dessen, was in einer Region nicht aufwandsarm produziert werden kann. »Es ist definitiv das Nachhaltigste, wenn auf jeder Fläche das produziert wird, was mit möglichst wenig Ressourcenaufwand dort produziert werden kann.« Reinhardt erinnert daran, dass die Möglichkeiten und Kapazitäten technischer Lösungen begrenzt sind.
In Klein-Eden, wo diese Grenzen ausgelotet werden, weiß man: »Was wir versuchen, geht nicht mit jeder Kultur. Zum Beispiel Ananas, Bananen und auch Mangos wirst du nie effizient bei uns anbauen können.« Und überall dort soll Schmitt zufolge guten Gewissens importiert und ein fairer Preis für ökologischere Produktion bezahlt werden: »Es könnte doch auch eine Banane – von der sollte man eh nicht mehr als eine täglich essen – dann 1–2 Euro kosten.«
Lockvogelbilanz

Auf dem Weg zu einer solchen Veränderung von Angebot und Nachfrage gibt es unterschiedliche Hürden. Schmitt beschreibt eine psychologische. Denn die vollen Regale, die sich KonsumentInnen erwarten, stünden als Prinzip auch hinter einem weiteren Phänomen: So manch tropische Frucht würde nur angeboten, um üppige Auswahl zu suggerieren, aber kaum je gekauft. »Die Sternfrüchte, die bei uns im Handel angeboten werden, schmecken nach gar nichts. Die werden allenfalls als Deko gekauft. Der Handel gibt dem KonsumentInnendruck nach, das anzubieten, aber das braucht doch keine und das kauft doch auch keiner.« Ähnlich würde es den Papayas ergehen: »Bei Aldi und Hofer steht immer eine Kiste Papayas. Die hat da, wenn sie in Salzburg oder Nürnberg rumsteht, 9 kg CO2 pro Kilogramm Flugtransport auf dem Buckel.« Würden auf jede gekaufte Papaya noch weitere im Handel weggeworfene einkalkuliert, ergäbe das einen nochmals anderen ökologischen Fußabdruck einer gekauften Papaya. »Die Menge, die tatsächlich verbraucht wird, kann bei uns klimafreundlicher angebaut werden« und würde auch besser schmecken, da sie reif geerntet werden kann und nicht erst auf dem langen Transportweg reift.
Sein Papaya-Versuch läuft derzeit auf 300 Quadratmetern Erdkultur und 300 Quadratmetern Topfkultur. In beiden Kulturen zeichne sich für das laufende Erntejahr über eine Tonne Ertrag ab. »Topfkultur ist wesentlich effizienter, wenn es gut läuft, werden es eher zwei Tonnen. Bayern hat 2018 1500 Tonnen Papayas importiert. Davon könnte ich 15 % bei uns decken, wenn wir zehn Hektar unter Glas hätten.«

Flugmango inkognito
Mehr regional und saisonal zu konsumieren und weniger zu importieren ist jedenfalls auch Reinhardt zufolge die einzige vernünftige Lösung. Produkte, die saisonal nicht verfügbar sind, sollten nicht zu sehr nach der Transportdistanz bewertet werden: »Den relevanten Unterschied macht der Anbau. Der Transport spielt ganz grob gesagt nicht die große Rolle, außer wenn mit dem Flugzeug transportiert wird.« Die Klassiker seien hier Ananas, Mango, Papaya. Ihr CO2-Abdruck ist eingeflogen 10 bis 15 Mal höher als der Transport über die Weltmeere. »Fluggemüse und Flugobst sind komplett abzulehnen«, betont Reinhardt – und ergänzt: »Laut Statistik gibt es allerdings kaum Flugmango in Deutschland«. Die in Deutschland erhältlichen Mangos kommen zu rund 80 % aus den Niederlanden, auch die dorthin eingeflogenen. Nach Deutschland würden allerdings die Mangos vom Hafen genau wie die Mangos vom Flughafen mit dem LKW transportiert.
Tiervideos
Auf dem Youtube-Kanal »Tropenhaus Klein Eden« wird regelmäßig nicht nur übertragen, was im Glashaus wächst, sondern auch, was dort kreucht und fleucht.
youtube.com
Aus Umweltsicht können und sollten wir Reinhardt zufolge auch klar sagen: »Wann immer ihr es euch leisten könnt, kauft Bio und Fair. Wenn’s Biofair nicht gibt, dann Bio. Das ist im Regelfall auch keine Flugware, weil Handel und VerbraucherInnen hier sensibilisiert sind.« Lebensmittel verbrauchen enorme Mengen Phosphatdünger, Fläche oder auch Wasser. Die Avocado etwa ist zum Symbol für den in Monokulturen gestillten großen Durst geworden. Wer ökologisch nachhaltige Avocados kaufen will, sollte laut Reinhardt die aus der Dominikanischen Republik denen aus Südamerika oder Israel vorziehen, weil letztere mit hoher Wahrscheinlichkeit bewässert werden müssen.
Ein nachhaltiger Anbau sei, sagt der Ökobilanzierer, nicht in erster Linie CO2-ärmer, aber auf jeden Fall insgesamt ökologischer: »Das kann ich für unterschiedliche Bereiche mit Zahlen belegen. Aber die Daten dazu, wie ArbeiterInnen auf einer Plantage im Krankheitsfall eine Lohnfortzahlung bekommen und nicht einfach rausgeworfen werden, die lassen sich nicht in Kilogramm CO2 ausdrücken. Muss man auch nicht.«
Was bedeutet Regionalität?
Was heißt regional? Unser Umgang mit Regionalität ist eine Geschichte voller Missverständnisse, gut gemeinter Fehleinschätzungen und gezielter Falschinformation. Wer sich beim Einkauf nicht ausschließlich vom Preis leiten lässt, achtet auf die Herkunft der gekauften Ware. Aber woran erkennt man die – und wie stark wirkt sich die Produktionsmethode, die Region und der Transport etwa auf die Klimabilanz eines Produkts aus?


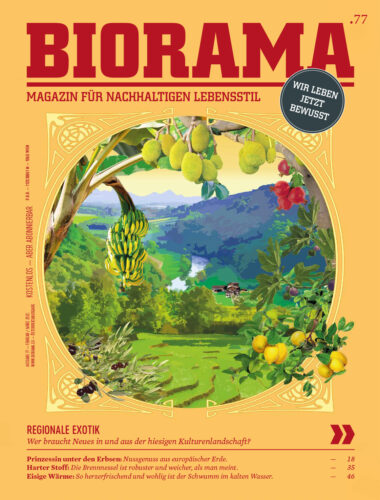







 Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.
Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.