„In Dänemark ist genetisch eigentlich gar nichts los“
Die Roten Listen der vom Aussterben bedrohten Arten werden von Tag zu Tag länger. Wir haben mit Dr. Frank Zachos vom Naturhistorischen Museum Wien gesprochen, der mit seiner Forschung dem Artensterben den Kampf angesagt hat. Seine Waffe: die Naturschutzgenetik.
BIORAMA: Die wenigsten werden sich unter „Naturschutzgenetik“ etwas vorstellen können. Würden Sie kurz erläutern, um was es sich dabei handelt?
Frank Zachos: Das Wort an sich kommt von dem englischen Begriff „conservation genetics“. Naturschutzgenetik ist Teil der Naturschutzbiologie, die sich mit Biodiversität, also der Artenvielfalt und deren Gefährdung und Erhalt beschäftigt. Man unterscheidet drei Ebenen von Biodiversität: die Ökosystemdiversität, die Artendiversität und die genetische Diversität innerhalb von Arten. Die Naturschutzgenetik befasst sich speziell mit der genetischen Diversität. Also: Wie kann man eine Art nicht nur als Art erhalten, sondern auch ihre genetische Vielfalt?
Wieso ist es wichtig, diese genetische Vielfalt innerhalb einer Art zu erhalten?
Zunächst mal ist das natürlich eine ethische oder eine philosophische Frage, keine wissenschaftliche. Natürlich existiert die Welt weiter, wenn es keine Tiger oder Eisbären mehr gibt. Es ist also letzten Endes ein gesellschaftlicher Konsens, den man erreichen muss. Wenn man sich darauf einigt, Arten zu erhalten, warum ist es dann wichtig, dass man sie in ihrer Gesamtheit erhält? Auch das ist zunächst mal eine eher philosophisch-moralische Frage. Wenn wir die Natur und – etwas pathetisch formuliert – die Schöpfung bewahren wollen, dann sollten wir das tun. Und wenn schon, dann richtig. Es ist nämlich so: Arten sind Produkte der Evolution und als solche mit einer bestimmten Bandbreite ausgestattet. Je größer diese genetische Variabilität ist, desto größer sind die Überlebenschancen der Art. Sie kann dann zum Beispiel besser auf sich ändernde Umweltbedingungen reagieren.
Welche Methoden wendet man in der Naturschutzgenetik an?
Sogenannte populationsgenetische Methoden. Zunächst einmal muss man DNA-Proben sammeln. Je nach Art, die man untersucht, sind das Federn, Kotproben oder auch Blut- und Gewebeproben. Bei Arten, wie etwa dem Rothirsch, steht die Jagd im Vordergrund. Wir sind mit der Jägerschaft in Kontakt und bekommen Gewebeproben von geschossenen Tieren. Wenn es sich allerdings um geschützte Populationen oder Unterarten handelt, geht das natürlich nicht. Wir haben zum Beispiel auch schon geschützte Populationen von Rothirschen untersucht. Da läuft das dann vor allem über Kotproben, aber auch mit Proben von Totfunden. Wenn die Tiere im Rahmen eines veterinärmedizinischen Monitorings betäubt werden oder mit Sendern ausgestattet werden, wird ihnen auch etwas Blut für genetische Untersuchung abgenommen. Aus jeder gesammelten Probe können wir dann im Labor den genetischen Fingerabdruck des Tieres gewinnen. Denn genau wie bei Menschen ist dieser auch in der Tierwelt bei jedem Individuum einzigartig. Wir sammeln also DNA-Proben von vielen Individuen einer Art und vergleichen sie miteinander. Typisch naturschutzgenetische Fragen, die wir dann damit beantworten können, sind zum Beispiel: Woher kommen die Individuen? Wie weit sind sie gewandert? Gibt es einen genetischen Austausch zwischen zwei Populationen, beispielsweise zwischen Hirschen in Niederösterreich und Hirschen in Vorarlberg?
Welche Arten haben Sie schon untersucht?
Ich bin Zoologe, vor allem Wirbeltierzoologe und mein Forschungsschwerpunkt liegt bei den Säugetieren. Ich beschäftige mich vor allem mit Huftieren – Antilopen, Gazellen, Hirschen – und Raubtieren, wie Braunbären, Iltisen und Schakalen. Erst kürzlich haben wir ein Projekt über Fischotter abgeschlossen. Die Projekte der Naturschutzgenetik laufen auch manchmal in Kooperation mit der IUCN, der International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, die die internationalen Roten Listen herausgibt. Da bin ich Mitglied in der Hirschgruppe.

Dr. Frank Zachos, Leiter der Säugetiersammlung des Naturhistorischen Museums Wien. Bild: Frank Zachos
Was haben Sie in dem Fischotter-Projekt untersucht und herausgefunden?
Bei den Fischottern ging es konkret um die Wiederbesiedlung von Gebieten, in denen der Fischotter ursprünglich mal ausgestorben war und zwar in Schleswig-Holstein im Norden Deutschlands. Da war der Fischotter weitgehend verschwunden, während es ihn in Dänemark und in Ostdeutschland noch gab. Inzwischen wurden Gebiete in Schleswig-Holstein wiederbesiedelt. Wir haben die neu ankommenden Fischotter genetisch untersucht und mit dänischen und ostdeutschen Fischotter-Proben verglichen. Wir wollten herausfinden, von wo sie einwandern, wie weit sie wandern und wie es mit ihrer genetischen Vielfalt aussieht. Ist die verringert, weil nur wenige Individuen einwandern? Wie sieht es aus mit der genetischen Unterschiedlichkeit zwischen der dänischen Population und der ostdeutschen Population? Profitiert etwa die kleine und genetisch sehr wenig variable dänische Population von einer Einwanderung aus dem Osten? Wir haben herausgefunden, dass die meisten Otter im schleswig-holsteinischen Bereich aus dem Osten kamen und einige wenige aus Dänemark. Die Fischotter sind sehr weit gewandert. Außerdem fanden wir heraus, dass sich in Schleswig-Holstein eine sehr variable kleine Population gegründet hat. Würden einige von ihnen nach Dänemark einwandern, würden die Fischotter dort sehr davon profitieren, denn in Dänemark ist genetisch eigentlich gar nichts los.
Wie kommt das?
Die genetische Variabilität bei den dänischen Ottern ist so gering, weil sie sehr isoliert sind. Außerdem gab es einen Zusammenbruch der Population im 20. Jahrhundert. Da hat sich durch Wasserverschmutzung und Reusenfischerei ihr Lebensraum extrem verschlechtert. Nur sehr wenige Tiere haben das überlebt. Das ist das Phänomen „Bottleneck“, bei dem sich aus einigen wenigen Exemplaren langsam wieder eine ganze Population aufbaut. Da geht dann sehr viel genetische Variabilität verloren. Daher ist die Fischotter-Population in Dänemark heute genetisch sehr verarmt.

Beim Bau von Wildbrücken wie dieser im Nationalpark Banff in Kanada, liefert die Naturschutzgenetik wichtige Informationen. Bild: flickr.com/afagen – CC BY-NC-SA 2.0
Werden die Ergebnisse Ihrer Arbeit auch von der Politik berücksichtigt?
Zum Teil ja. Wir hatten zum Beispiel ein Projekt über die Auswirkung der Lebensraumzersiedlung durch Siedlungs- und Autobahnbau auf die Hirschpopulation. Gerade, wenn Autobahnen zur Verhinderung von Wildunfällen umzäunt werden, muss man sich die Frage stellen, wie sich das genetisch auswirkt und wo der Bedarf besteht, für Austausch zu sorgen. Das Projekt war nicht nur genetischer Natur, es wurden auch Tiere besendert, um ihre Wanderungen nachzuvollziehen und um herauszufinden, wo sie die Straße überqueren würden, wenn sie könnten. Die Ergebnisse flossen dann in die Planung von Wildbrücken ein, um für Genfluss über die Autobahn hinweg zu sorgen. Die Wildbrücken kosten einige Millionen Euro und man will sich schließlich sicher sein, dass diese dann auch genutzt werden. Das Besondere an den Hirschen ist, dass sie sogenannte umbrella species, also Schirmarten sind. Das heißt, wenn man Lebensraum oder Migrationsmöglichkeiten für Hirsche schafft, schafft man gleichzeitig auch Migrationsmöglichkeiten und Lebensraum für viele andere kleinere Arten.
Will die Politik die verschiedenen verpflichtenden Abkommen von Staaten und Staatengemeinschaften wirklich sinnvoll umsetzen, dann wird sie um Erkenntnisse der Naturschutzbiologie oder Naturschutzgenetik nicht herumkommen. Da besteht bisher aber durchaus noch Luft nach oben.
- #Autobahn
- #Biodiversität
- #Bottleneck
- #conservation genetics
- #DNA
- #Frank Zachos
- #gefährdete Tierarten
- #genetische Vielfalt
- #Grünbrücke
- #IUCN
- #jäger
- #Lebensraumzersiedlung
- #lebensraumzerstörung
- #Monitoring
- #Naturhistorisches Museum Wien
- #Naturschutz
- #Naturschutzbiologie
- #Naturschutzgenetik
- #Ökosysteme
- #Otter
- #politik
- #Reusenfischerei
- #rote Liste
- #rothirsch
- #Wildtierbrücke



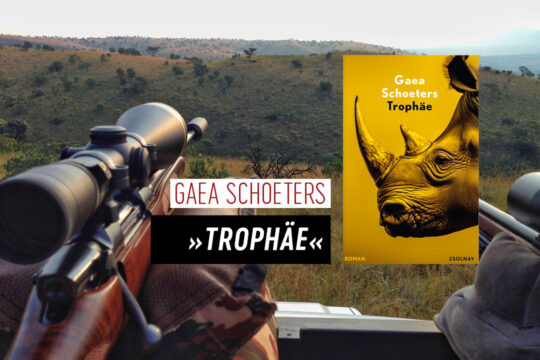






 Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.
Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.